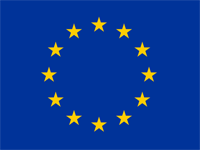
Die EWG und deren Perzeption in der deutschen Öffentlichkeitvon Björn Böhling
|
2.2. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS / Montanunion)
Der sich seit der Gründung beider deutscher Staaten 1949 verhärtende Ost-West-Konflikt, das Auslaufen des Marshall-Plans und die Notwendigkeit der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Europa trieben die Integration voran. Im Ergebnis entstand eine wirtschaftliche Gemeinschaft von sechs europäischen Staaten, die zunächst auf den Kohle- und Stahlsektor begrenzt blieb. Aber das Bemerkenswerteste an dieser Gemeinschaft war: „Erstmals gelingt hier die supranationale Organisation eines zentralen Politikbereichs, der bislang allein in nationalstaatlicher Kompetenz gelegen hatte“.[30]
Der damalige französische Außenminister Robert Schuman und der Leiter des Amtes für wirtschaftliche Planung Jean Monnet ergriffen 1950 die Initiative zum Aufbau einer supranationalen Organisation zwischen Frankreich und Deutschland, die allen anderen europäischen Staaten offen stand. Am 18. April 1951 unterschrieben die Regierungen von Frankreich, Deutschland, Belgien, Italien, Luxemburg und den Niederlanden den so genannten Montanvertrag in Paris, der die Bildung eines gemeinsamen Marktes für die damaligen Schlüsselindustrien Kohle und Stahl vorsah.[31]
Die Frage, warum gerade die Franzosen nur fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bereit waren, Deutschland in diese Organisation aufzunehmen, lässt sich wirtschaftlich und politisch beantworten. Erstens konnte man die Industrien an Rhein und Ruhr, besonders die Stahlindustrie, die wesentlich zur Aufrüstung des Deutschen Reiches beigetragen hatte, unter europäische Kontrolle bringen, und zweitens war Frankreich auf die deutsche Kohle angewiesen, um selber Eisenerz schmelzen zu können.[32] Fritzler und Unser stellen als weiteren Grund die sich anbahnende deutsch-französische Versöhnung heraus und geben den politischen Willen an, die Montanunion als ersten Schritt zu einer europäischen Föderation, eines europäischen Bundesstaates zu sehen.[33] Demzufolge ging man nach dem funktionalistischen Integrationsprinzip vor, d.h. die politisch Verantwortlichen gingen davon aus, dass sich, wenn ein Wirtschafts- oder Politikbereich erst einmal integriert war, sich sachlogisch weitere Teile anschließen würden.[34] Dem Kohle- und Stahlsektor sollten bald weitere Sektoren bis zur politischen Einigung folgen.
Auf deutscher Seite war sowohl der Beitritt als auch die Abgabe von Hoheitsrechten für Bundeskanzler Adenauer trotz Widerspruchs im Land, besonders bei der SPD, die den „Schuman-Plan ... wegen vermeintlicher wirtschaftlicher Nachteile für die Bundesrepublik (‚Europa-AG’) leidenschaftlich, aber erfolglos“ bekämpfte,[35] keine Frage, konnte er doch so die junge Bundesrepublik wieder in das Orchester des europäischen Staaten zurückholen, „kam von den diskriminierenden Belastungen durch die Internationale Ruhrbehörde ... frei“[36] und konnte ebenfalls das Ziel der deutsch-französischen Aussöhnung verfolgen.[37]
Bereits dieser begrenzte Versuch der Abtretung hoheitlicher Kompetenzen fand in Großbritannien keinen Zuspruch. Dem Föderalismus skeptisch gegenüber eingestellt, schlossen sie lediglich ein Assoziierungsabkommen mit der Montanunion. Graml zählt dies zu den „Schattenseiten“ der Montanunion, zieht aber trotzdem ein positives Fazit, denn „der Erfolg des Schuman-Plans, der sich schon früh abzeichnete, [gab] der westeuropäischen Einigungsbewegung fraglos neue Impulse.“[38]
Die oberste Aufsicht über den Stahl- und Kohlemarkt wurde im Rahmen der EGKS einer Hohen Behörde unterstellt, die exekutive Aufgaben wahrnahm. Sie bestand aus neun Mitgliedern, war eine von den Mitgliedsstaaten unabhängige Behörde in Luxemburg und hatte für das Ziel des Zusammenschlusses, für Förderung und Verbesserung des zwischenstaatlichen Handels durch Verbot der Zölle und für andere Mittel, wie die mengenmäßige Festlegung des Handelsvolumens, zu sorgen.[40] Eine Gemeinsame Versammlung, die aus Parlamentariern der nationalen Parlamente gebildet wurde, besaß die Qualität eines Diskussionsgremiums mit eingeschränkten Kontrollrechten. Beim Ministerrat lagen die Richtlinien- und Legislativrechte und ein elfköpfiger Gerichtshof überwachte die Einhaltung der Verträge und sorgte für Klarheit bei Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedern. Außerdem wurde ein beratender Ausschuss mit Vertreten der beteiligten Interessengruppen eingeführt.
Interessant bei diesen Strukturen ist, dass man ursprünglich nur die Hohe Behörde als Organ vorgesehen hatte. Doch schon früh wurden Bedenken wegen deren unkontrollierbarer Machtfülle laut, so dass erst der Ministerrat als Leit- und Kontrollorgan der Regierungen und dann die Gemeinsame Versammlung als politisch schwaches Organ der nationalen Parlamente hinzukam.
Trotz allem erwies sich die Struktur der europäischen Organe als ‚Erfolgsmodell’. Sie wurde, trotz vieler Vertragsänderungen und -zusammenschlüsse, bis in die Gegenwart hinein beibehalten.
[30] Weidenfeld 2002, S. 22.
[31] Der Vertrag trat 1952 in Kraft und lief im Jahr 2002 auch aufgrund der abnehmenden Bedeutung dieses Marktes aus.
[32] Vgl. Fritzler, Unser 2001, S. 19 und Weidenfeld, Wessels 2001, S. 14.
[33] Vgl. Fritzler, Unser 2001, S. 19f. In der Gewichtung sind sich die Zeithistoriker uneinig. So sehen Weidenfeld und Wessels an erster Stelle die Beseitigung der deutsch-französischen Erbfeindschaft und an zweiter Stelle die Schaffung eines Grundsteins für eine europäische Föderation (vgl. Weidenfeld, Wessels 2001, S. 14).
[34] Vgl. u.a. Weidenfeld 2002, S. 22.
[35] Morsey, Rudolf: Die Bundesrepublik Deutschland, Entstehung und Entwicklung bis 1969, München 1987, S. 26.
[36] Schieder 1979, S. 327.
[37] Vgl. Gros 2002, S. 100f.
[38] Graml 1983, S. 77.
[39] Quelle: http://www.laurentianum.waf-online.de/rap2k/euroins2.htm; Download: 31.3.2003.
[40] Vgl. Schieder 1979, S. 327.
Inhalt
- 1. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
- 2. Vorgeschichte: Der Beginn der europäischen Integration nach 1945
- 2.1. Die ersten Schritte zur europäischen Integration durch die Europäer – Die Europäische Bewegung und der Europarat
- 2.2. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS / Montanunion)
- 2.3. Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) und die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG)
- 3. Darstellung: Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
- 4. Analyse: Die EWG in der veröffentlichten Meinung der deutschen Presse von 1957/58
- 4.1. Die Bild
- 4.2. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
- 4.3. Das Handelsblatt
- 4.4. DIE WELT
- 4.5. DIE ZEIT
- 4.6 DER SPIEGEL
- 4.7. Zusammenfassung und Ergebnisse
- 5. Analyse: „Haben Sie schon einmal die Bezeichnung ‚Gemeinsamer Markt’ gehört oder gelesen?“ – Eine empirische Erhebung zur EWG in Deutschland 1957/58
- 6. Ergebnisse
- 7.1. Anhang: Schlusserklärung der Konferenz von Messina
- 7.2 Anhang: Präambel des EWG Vertrages (1957)
- 7.3. Anhang: Schematische Zusammenfassung der Ergebnisse der Zeitungs- und Zeitschriftenanalyse.
- 8. Zeitleiste
- 9. Quellen
- 10. Literatur
- Links