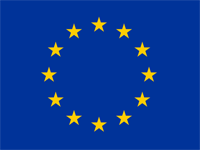
Die EWG und deren Perzeption in der deutschen Öffentlichkeitvon Björn Böhling
|
3. Darstellung: Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
Ende 1954 forderte die Gemeinsame Versammlung der EGKS, die eigentlich aufgrund ihrer Statuten und beschränkten Rechte wenig zu fordern hatte, die Einsetzung einer Sonderkommission, welche die Stärkung der Gemeinschaft und die Erweiterung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit prüfen sollte. Ein weiterer Impuls ging von den Benelux-Staaten aus. Der niederländische Außenminister stellte im April 1954 fest:
„Wenn wir zum politischen Zusammenschluss gelangen wollen, müssen wir an das Problem unter dem Gesichtswinkel der Gesamtwirtschaft herangehen; denn die Wirtschaftsmacht stellt die für die Aufrechterhaltung der politischen Einheit Europas notwendige Infrastruktur dar.“[47]
So sollte „Die immer engere wirtschaftliche Zusammenarbeit ... der Motor und Wegbereiter für die später folgende politische Einheit sein.“[48]
Auf einer Konferenz in Messina im Juni 1955[49] beschlossen die sechs Außenminister trotz des Rückschlags im Einigungsprozess Europas, die EGKS als Vorbild für eine ausgedehntere, weitere Bereiche umspannende wirtschaftlichen Vereinigung zu nutzen. Sie bereiteten eine Regierungskonferenz über eine Zollunion und eine Organisation für die Entwicklung und Nutzung der Kernenergie vor. „Hinzu kam, dass in Anbetracht der dominierenden Stellung der USA auf dem Weltmarkt ein engeres wirtschaftliches Zusammenrücken Westeuropas geboten schien.“[50] Der belgische Außenminister Paul Henri Spaak wurde zum Vorsitzenden einer Kommission ernannt, die die in Messina ausgearbeiteten Richtlinien auf ihre praktische Verwirklichung hin prüfen sollte. Der so genannte Spaak-Bericht wurde im Februar 1956 den zuständigen Ministern übergeben.
Am 25.März 1957 wurden schließlich in Rom[51] die Verträge zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und zur Europäischen Atomgemeinschaft (EAG bzw. EURATOM) unterzeichnet.[52] Bei den EWG- und EAG-Verträgen lässt sich ein Merkmal europäischer Integrationspolitik erkennen, das bis in die Gegenwart Bestand hat – nämlich das ‚Schnüren von Paketen’.[53] Damit ist gemeint, dass kaum eigenständige Verträge zustande kommen, sondern dass sie immer an andere gekoppelt sind, um Kompromisse zwischen den Mitgliedsstaaten zu vereinfachen. Praktisch hieß das: Keine EWG ohne EAG oder keine EPG ohne EVG – wie man leidvoll erfahren hatte.
Am 1. Januar 1958 traten die neuen Verträge in Kraft und führten zu einer Veränderung der europäischen Institutionen unter Beibehaltung der von der EGKS her bekannten Strukturen. Die Abbildung 2 zeigt schematisch die Einrichtungen der EWG.[54]
Textfeld: Abb. 2: Die Organe der EWGDer Ministerrat setzte sich aus den jeweiligen nationalen Fachministern zusammen und entschied per Mehrheitsbeschluss. Nur in Ausnahmefällen war eine qualifizierte Mehrheit erforderlich, bei der das Gewicht der einzelnen Länder zum Tragen kam. Das Europäische Parlament hatte, wie die Gemeinsame Versammlung, nur beratende und kontrollierende Funktion, die Mitglieder wurden von den nationalen Parlamenten entsandt. Im Zuge der europäischen Integration stieg die Abgeordnetenzahl stark an. Erst im Jahr 1979 durften die Bürger der EG das Parlament direkt wählen. Die Kommission bestand nach der Gründung der EWG aus neun Kommissaren mit einem beigeordneten Sekretariat.
Folgende Ziele hatten sich die teilnehmenden Staaten gesetzt:[55]
· Freihandelszone, d.h. ein gemeinsamer Markt (eine stufenweise Abschaffung der Zölle und mengenmäßigen Beschränkungen innerhalb eines Zeitraums von höchstens fünfzehn Jahren);
· Zollunion (Einführung eines gemeinsamen Außenzolltarifs und einer gemeinsamen Handelspolitik gegenüber Drittländern);
· Gemeinsame landwirtschaftliche Marktordnung;
· Gemeinsame Verkehrspolitik;
· Gemeinsame Wettbewerbsregeln im Sinne eines grundsätzlichen Kartellverbots;
· Harmonisierung der Arbeitsbedingungen und Schaffung eines europäischen Sozialfonds;
· Angleichung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften, soweit dies für das ordnungsgemäße Funktionieren des gemeinsamen Marktes erforderlich ist;
· Assoziierung der überseeischen Länder und Hoheitsgebiete zur Steigerung ihrer wirtschaftlichen Entwicklung. Ein Protokoll regelte die Probleme, die sich für die Gemeinschaft aus der Teilung Deutschlands und des innerdeutschen Handels ergaben.
Der Erfolg dieser Wirtschaftsgemeinschaft ließ nicht lange auf sich warten – auch wenn man beachten muss, dass z.B. der vorgesehene Gemeinsame Binnenmarkt seine Erfüllung erst im Jahre 1993 anstatt nach den vorgesehenen 12 Jahren fand. Da auf die Zeit der Krisen und Rückschläge im Integrationsprozess und somit auch während der Zeit der EWG hier nicht eingegangen werden soll, werden im Folgenden nur kurze Stichworte geliefert, um dem Leser wenigstens ein ‚rundes Bild’ der EWG zu liefern. Positive Aspekte der Entwicklung im EWG-Raum können wie folgt charakterisiert werden:[56] Wirtschaftswachstum, Erhöhung des Bruttosozialprodukts und der Industrieproduktion, Aufstieg zum bedeutendsten Handelspartner der Welt, größter Importeur, zweitgrößter Exporteur, Wachstumssprünge im innergemeinschaftlichen Warenaustausch, Zunahme des Warenangebots für die Konsumenten, Zusammenwachsen der Mitgliedsstaaten und Ausgleichung regionaler Wirtschaftsunterschiede, Abbau von Handelshemmnissen, Abschaffung von Binnenzöllen, wachsende Attraktivität der EWG und Beitrittswünsche anderer Staaten. Doch auch Misserfolge oder negative Auswirkungen mussten verzeichnet werden: Es kam zu Konflikten mit der Sowjetunion, weil das kommunistische Pendant zur EWG, der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), nicht im Entferntesten an die Erfolge anknüpfen konnte. Schließlich, so meint Gasteyger, war die EWG „der sichtbare Widerspruch zu Lenins These von der ‚Unmöglichkeit dauerhafter Zusammenschlüsse kapitalistischer Staaten’ und zugleich der unwiderlegbare Beweis dafür, dass eine solche Gemeinschaft nur auf der Grundlage der Freiwilligkeit und Gleichberechtigung ihrer Glieder gedeihen kann.“[57] Die Agrarzölle sanken aufgrund nationaler Hindernisse (u.a. Bauernproteste) langsamer, allerdings löste die europäische Agrarmarktordnung doch langsam die innerstaatlichen Marktordnungen ab. Aufgrund von Subventionen und Garantiepreisen in der Landwirtschaft kam es zu europäischen ‚Butterbergen’ und ‚Milchseen’. Und die Grenzkontrollen mussten wegen fehlender Angleichung der Steuergesetzgebung beibehalten werden.
Die Hohe Behörde der EGKS verschmolz erst 1967 mit den Exekutivorganen der EWG und EAG zur Europäischen Kommission. Bis dahin hatte es drei Kommissionen für jede Teilgemeinschaft gegeben. Weiterhin gab es nur eine Gemeinsame Versammlung, die nun Europäisches Parlament hieß, und einen Gerichtshof. Jede Teilgemeinschaft verfügte über einen Ministerrat. Ergänzt wurden die Einrichtungen durch einen Wirtschafts- und Sozialausschuss und die Europäische Investitionsbank, die wenig entwickelte Wirtschaftsräume des EWG-Raumes finanziell unterstützen sollte. Die drei Teilgemeinschaften EGKS, EWG und EAG gingen in den Europäischen Gemeinschaften (EG) auf, ohne ihre vertragliche Selbständigkeit zu verlieren.
Zu einem gemeinsamen Europa konnte die EWG zumindest kurzfristig nichts beitragen, im Gegenteil. Großbritannien, das sich dem Commonwealth näher fühlte als den Europäischen Gemeinschaften, bemühte sich, eine kleine europäische Freihandelszone zu bilden, nachdem dies im Rahmen der OEEC für ganz Europa misslungen war. Am 20.11.1959 unterzeichnete es mit einigen neutralen Staaten die Konvention der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA).[58]
Trotz dieser wenigen Schönheitsfehler muss doch konstatiert werden, dass die EWG eine beispiellose Erfolgsgeschichte aufzuweisen hat. Sie brachte wirtschaftlichen Aufschwung in Europa und müsste sich, so die hier aufgestellte Arbeitsthese, schon bei der Ankündigung 1957 bei der europäischen Bevölkerung größter Beliebtheit und Kenntnis erfreut haben. Gerade dies soll exemplarisch anhand der deutschen Bevölkerung im Folgenden überprüft werden. Dabei werden zunächst deutsche Tageszeitungen nach der Unterzeichnung der Verträge in Rom, der Ratifizierung im Deutschen Bundestag und um zum Zeitpunkt des Inkrafttretens analysiert,[59] um den Grad der Informiertheit der Bevölkerung festzustellen und den Grundtenor der Berichterstattung der Presse zu beleuchten. Aufgrund dieser Grundlagen werden im folgenden Kapitel dann empirische Erhebungen des Instituts für Demoskopie Allensbach[60] vorgestellt und die Leitfrage der Perzeption der EWG in der deutschen Bevölkerung beantwortet.
Einen Vergleich der europaischen Finanz- und Sozialsysteme finden Sie Hier.
[47] Zitiert nach Gasteyger 2001, S. 146.
[48] Gasteyger 2001, S. 146f.
[49] Zu der Schlusserklärung der Konferenz siehe den Ausschnitt in Anlage III im Anhang.
[50] Fritzler, Unser 2001, S. 22.
[51] Daher wird die EWG auch oft als ‚Römische Verträge’ bezeichnet. Zum EWG-Vertrag siehe die Präambel in Anlage IV im Anhang.
[52] Zu EAG bzw. EURATOM soll hier nur kurz erwähnt werden, dass diese Gemeinschaft dem Zweck dienen sollte, „Aufbau und Entwicklung der Nuklearindustrie in den sechs Mitgliedstaaten zu fördern.“ (Weidenfeld, Wessels 2001, S. 16.)
[53] Vgl. Weidenfeld 2002, S. 23.
[54] Quelle: Das moderne Lexikon in zwanzig Bänden, hrsg. vom Lexikon Institut Bertelsmann in Zusammenarb. Mit Dr. Hans F. Müller, Berlin u.a. 1971, Bd. 5, S. 367.
[55] Vgl. Gasteyger 2001, S. 147f und Weidenfeld 2002, S. 23.
[56] Vgl. Gasteyger 2001, S. 148f und Weidenfeld, Wessels 2001, S. 17.
[57] Gasteyger 2001, S. 148.
[58] Vgl. Raulff, Heiner: Die Entwicklung in Westeuropa bis zur Direktwahl des Europäischen Parlaments, in: Benz, Wolfgang; Graml, Hermann (Hrsg.): Europa nach dem Zweiten Weltkrieg 1945-1982, Das Zwanzigste Jahrhundert II, Frankfurt a.M. 1983, S. 295. Im Laufe der Zeit traten viele EFTA-Mitglieder der EG bei. Siehe zu EWG und EFTA die Karte in Anlage V im Anhang.
[59] Die Vorlage zur Zeitungsanalyse liefert Klaus Fieberg in „Zeitungen im Geschichtsunterricht“, in: Praxis Geschichte 14 (2002), 4, S. 31-38.
[60] Das Institut Allensbach stellte dankenswerter Weise, aber leider als einziges Institut, Daten zur Verfügung. So ist es bedauerlich und ärgerlich, dass diese Auswertung nur mit Hilfe monoperspektivischen Quellenmaterials erfolgen kann.
Inhalt
- 1. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
- 2. Vorgeschichte: Der Beginn der europäischen Integration nach 1945
- 2.1. Die ersten Schritte zur europäischen Integration durch die Europäer – Die Europäische Bewegung und der Europarat
- 2.2. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS / Montanunion)
- 2.3. Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) und die Europäische Politische Gemeinschaft (EPG)
- 3. Darstellung: Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG)
- 4. Analyse: Die EWG in der veröffentlichten Meinung der deutschen Presse von 1957/58
- 4.1. Die Bild
- 4.2. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ)
- 4.3. Das Handelsblatt
- 4.4. DIE WELT
- 4.5. DIE ZEIT
- 4.6 DER SPIEGEL
- 4.7. Zusammenfassung und Ergebnisse
- 5. Analyse: „Haben Sie schon einmal die Bezeichnung ‚Gemeinsamer Markt’ gehört oder gelesen?“ – Eine empirische Erhebung zur EWG in Deutschland 1957/58
- 6. Ergebnisse
- 7.1. Anhang: Schlusserklärung der Konferenz von Messina
- 7.2 Anhang: Präambel des EWG Vertrages (1957)
- 7.3. Anhang: Schematische Zusammenfassung der Ergebnisse der Zeitungs- und Zeitschriftenanalyse.
- 8. Zeitleiste
- 9. Quellen
- 10. Literatur
- Links